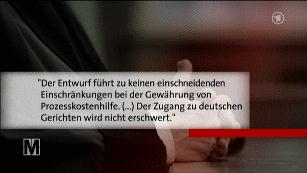In der Dokumentation "versichert und verschaukelt" (3-sat, 10.01.14) wird
u.a. von dem Versicherungsfall des Horst G. berichtet, der noch der ZPO-Reform von 2002
unterlag. Seine Klage sei in erster und zweiter Instanz abgewiesen worden. Sein Problem
sei gewesen, daß er sein Problem nicht selbst hätte vortragen können, weil das der §
522 ZPO verhindert habe. Dieser Paragraph hätte zugelassen, daß die Klage abgewiesen
werden konnte, ohne den Kläger angehört zu haben. Diese Entscheidung hinter
verschlossenen Türen wurde rechtskräftig und Rechtsmittel dagegen waren nicht mehr
möglich. Für den ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam war der Paragraph dafür gedacht,
völlig einfache und sonnenklare Fälle so zu entscheiden. Man habe dann aber diese
Möglichkeit auch für schwierige Fälle genutzt, wofür sie garnicht gedacht war, wie
z.B. schwierige Arzthaftungsfälle, wo man schwierige Gutachten und Zeugen, sowie Beweise
erheben muß. Da sei sein Eindruck gewesen, daß Richter ab und zu diesen Pragraphen dazu
benutzt hätten, um diese dicken Aktenberge schnell vom Tisch zu bekommen, um kurzen
Prozeß zu machen und das zum Teil auf dem Rücken der Kläger.
An dieser Darstellung ist vieles falsch. Zum einen hat der § 522 ZPO keinen Einfluß auf
die erste Instanz. Auch wird der Kläger in beiden Instanzen gehört. Im Fall eines
fehlenden Anwalts geschieht das im Rahmen des PKH-Verfahrens. Der Mangel liegt bei
anwaltlicher Vertretung in der zweiten Instanz darin, daß aufgrund des § 522 ZPO keine
Hauptverhandlung mehr stattfinden muß, wenn die Richter einstimmig feststellen, daß die
Berufung keine Aussicht auf Erfolg hat, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung
hat, die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine
Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert. Hier hatte der Gesetzgeber diesen
Richtern viel Spielraum in die Hände gelegt, ohne eine höherinstanzliche
Überprüfungsmöglichkeit eingebaut zu haben. Maßgeblich ist aber noch der § 531 ZPO,
der neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur zuläßt, wenn sie einen Gesichtspunkt
betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für
unerheblich gehalten worden ist, infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht
geltend gemacht wurde oder sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne
das dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. Hier ist eben nicht die Frage der
einfachen oder schwierigen Fälle maßgebend. Gerade bei schwierigen Fällen fällt es
einer Partei oft schwer, innerhalb der ersten Instanz allen Sach- und Beweisvortrag mit
einem Mal liefern zu können und damit den prozessualen Anforderungen gerecht zu werden.
Dieser Partei wurde und wird auch heute noch der § 522/2 Ziff. 1 iVm § 531 ZPO zum
Verhängnis, auch wenn die aktuelle Gesetzeslage nun das Rechtsmittel der Revision (idR
über Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH) erlaubt. Die §§ 543/2, 551 und 559 ZPO lassen
lediglich grundsätzlich bedeutende Fälle etc. (wie bei § 522) zu, daß das
Revisionsgericht nur das Parteivorbringen zu berücksichtigen hat, was aus dem
Berufungsurteil oder dem Sitzungsprotokoll ersichtlich ist. Selbst Wahrheitsfestellungen
des vorinstanzlichen Gerichts bleiben unangreifbar. Das heißt übersetzt, daß das Urteil
nur in rechtlicher und nicht mehr in tatsächlicher Hinsicht überprüft wird. Neues
Vorbringen und neues Beweismaterial sind ausgeschlossen. Lediglich Tatsachen im Rahmen der
Klärung von Verfahrensfehlern sind erlaubt und wenn sie ein Wiederaufnahmeverfahren
zuließen.
Der Urtyp des Prozeßrechts bestand ausschließlich in eindeutig festgelegten
Formalitäten und Verfahrensalgorithmen. Das höchste Gericht war uneingeschränkt
anrufbar, was eine hohe Entscheidungsqualität der unteren Gerichte erforderte, denn sonst
würde es überlastet. Beim Revisionsgericht (BGH) gibt es schon länger spezielle
Zulassungsgründe (Bedeutung, zum BGH abweichende Entscheidung, ab 60000 DM). Das war,
abgesehen von den 60000 DM (§ 546 ZPO bis 2001) noch vertretbar. Die Berufung wiederum
war erst ab einem Streitwert von 1500,- DM zulässig.
Mit der ZPO-Reform 2002 fiel der hohe Streitwert (Beschwer) für eine
Nichtzulassungsbeschwerde für eine Revision auf 20000 € (§ 26 Nr. 8 EGZPO; aktuell
§ 544 Abs. 2 Ziff. 1 ZPO). Ob dem Gesetzgeber der Erhalt des Wertes der Beschwer in der
ZPO zu peinlich war, ist nicht bekannt. Jedenfalls stand hierdurch der BGH unter
Mehrbelastung, weil viele Betroffene von dieser Regelung keine Kenntnis hatten.
Mit der ZPO-Reform 2002 erhielt die Berufung mit § 522 Abs. 2, 3 ZPO das Erfordernis
ähnlicher Zulassungsgründe wie beim BGH (außer Streitwert). Der Beschluß des
Berufungsgerichts ist aber unanfechtbar. Zweck war offiziell, offenkundige und damit
überflüssige Berufungsverfahren zu vermeiden (Prozeßökonomie) und den BGH zu
entlasten.
Der Bundestag hatte am 05.03.09 nun über den § 522 Abs. 2, 3 wegen eines Antrags der
FDP zu beraten, weil diese Vorschrift in den Bundesländern sehr unterschiedlich
gehandhabt würde. Die Abgeordnete Mechthild Dyckmans (FDP, Richterin) verwies auf eine
hohe Kritik (Anwaltskanzleien) gegen diese Vorschrift. Es müsse mindestens die
Unanfechtbarkeit entfallen. Das BVerfG sehe darin keinen Verfassungsverstoß, die FDP aber
ein Gerechtigkeitsproblem. Es gäbe erheblich unterschiedliches Entscheidungsverhalten in
den einzelnen Ländern, woraus sich die Frage ergibt, ob der Zugang zum Recht für alle
Bundesbürger in der gleichen Weise eröffnet ist. Da bzgl. der Unzulässigkeit sonstiger
Formerfordernisse die Rechtsbeschwerde möglich ist (§ 552/1 ZPO), sei nicht einzusehen,
warum dies nicht auch für Abs. 2 gelten soll.
Der Abgeordnete Gehb (CDU, ein Richter) meinte in seiner wiederum exzentrischen
Vortragsweise (Ablenkung vom Plausiblen), der Antrag der FDP sei schon im Ansatz verfehlt,
weil der den Abs. 2 nicht richtig widergibt (oder statt und, wahrscheinlich ein Versehen
der FDP). Desweiteren verlange die FDP die Nichtzulassungsbeschwerde bei abweisenden
Urteil, die jedoch gem. § 544 ZPO im Urteil die Nichtzulassung der Revision voraussetzt.
(Offensichtlich wollte die FDP sogar ein Urteil (statt Beschluß) und die Einführung der
Nichtzulassungsbeschwerde und ist aber an der richtigen Interpretation der
Verfahrensvorschriften gescheitert). Deshalb meint Herr Gehb, er habe schon oft von dieser
Stelle aus gesagt, wer die Begrifflichkeit beherrscht, kann auch eine Diskussion
beherrschen (da hat er noch recht). In der Entscheidung des BVerfG vom 04.11.08 habe dies
zu einem speziellen Verfahren festgestellt, daß der Paragraph in einer den
Justizgewährungsanspruch verletzenden Weise angewendet worden sei. Dann sei auch mit
einer Rechtsbeschwerde nichts anderes zu erreichen, weil der BGH auch nichts anderes
entscheiden würde. Man hätte sogar eine Verdopplung des Rechtsmittelverfahrens, weil
nach neuerlicher Entscheidung des Berufungsgerichts dann noch die
Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen wäre. Desweiteren sei die Rechtsbeschwerde in Abs. 1
etwas anderes, weil in der Sach-Entscheidung zu Abs. 2 die Sache mit voller Tiefenprüfung
ergehe (Satz 2 ist gemeint). Zum Schluß gab er noch Hinweise über das komplizierte
Entscheidungsverfahren und es unmöglich sei, daß alle beteiligten Richter rechtswidrig
handeln würden.
Herrn Gehbs Angebot einer völligen Neuordnung der Vorschrift könnte dem Umstand
geschuldet sein, daß sich weiterhin statistisch nachweisen läßt, daß viele Gerichte
diese Vorschrift für rechtswidrige Entscheidungen nutze oder er nur von seinem
Nichtwillen ablenken wollte. Er geht mit keinem Wort auf die vorliegenden Beschwerden der
Kanzleien noch die Differenz im Entscheidungsverhalten der Gerichte ein. Er unterstellt
zudem, das BVerfG wäre neuerdings hocherfreut darüber, daß es selbst nun wieder die
ganze Last der an unteren Fachgerichten häufiger vorkommenden Fehlentscheidungen tragen
will. Und es wird unterstellt, das BVerfG müsse jede Verfassungsbeschwerde annehmen, die
eine Grundrechtswidrigkeit nachweist. Tatsächlich hatte die angeführte
BVerfG-Entscheidung Ausnahmecharakter, weil das Gericht offenbar erstmalig ein solches
Problem zu entscheiden hatte. Eine weitere ähnlich gelagerte Verfassungsbeschwerde würde
als unzulässig erklärt (Ausnahme offiziell: bei Schwerwiegenheit). Allerdings die
Gehörsrüge gem. § 321a ZPO ist, wie die Statistik zeigt und wie auch allgemein bekannt,
wirkungslos und dient im Irrgarten des Prozeßrechts wiederum nur zur Abwehr potentieller
Rechtsuchender und zur Gerichtskostensteigerung. Insofern ist z.B. die Entscheidung 1 BvR
644/05 nur reine Heuchelei der Bundesverfassungsrichter.
Der Abgeordnete Neskovic (Linke, Richter) meinte, man habe mit dem Reformgesetz das
Recht der Berufung nicht reformiert, sondern deformiert, weil sie dem Menschen nichts
nützt. Die Möglichkeit der erstinstanzlichen Überprüfung sei drastisch eingeschränkt
worden. Die Entlastung der Rechtsprechung sei eine Belastung für die Menschen.
Justizministerin Zypries (SPD) hielt klar fest, der § 522 bleibt in seiner aktuellen
Fassung erhalten. Es ging bei der Einführung um raschen und effektiven Rechtsschutz. Auch
schnelles Recht ist gutes Recht. Herr Gehb habe die Sache sehr gut vorgetragen. Man habe
jetzt schnellere Berufungsverfahren und zwar ohne rechtsstaatliche Grundsätze
freizugeben. Die Länderumfrage des Bundesministeriums der Justiz sei eine falsche
Darstellung. Auf Einwand vom Abgeordneten Montag (Grüne) hin, sah sie dann einen weiteren
Prüfungsbedarf. Die Erfolgsquote der Zulassungsrevisionen beim BGH könne man aber nicht
heranziehen, denn die umfaßt auch die Fälle, in denen der Berufung zu Unrecht
stattgegeben wurde. Hinsichtlich des Beschwerderechts des Abs. 1 finde im Gegensatz dort
keine inhaltliche Überprüfung des erstinstanzlichen Urteils statt.
Auf die Beschwerden der Anwaltskanzleien ging sie u.a. nicht ein.
Der Abgeordnete Montag (Grüne, Richter) sah in der Entlastung der Justiz und in
schnelleren Urteilen keine Werte an sich. Die Rechtsstaatlichkeit dürfe darunter nicht
leiden. Da die Richter nach § 522 Abs. 2 kein Ermessen haben, könne es keine
überragende Spreizung nach den Bundesländern geben. Die Zahlen des Justizministerium
seien ein Indiz an sich. Von den Nichtzulassungsbeschwerden auf ein Berufungsurteil hin,
seien 20 % erfolgreich. Das bedeute, jede fünfte von den Berufungsgerichten nicht
zugelassene Revision sei zu Unrecht nicht zugelassen worden. Von den eingelegten
Revisionen wiederum seien 80 % beim BGH erfolgreich. Deshalb könne man davon ausgehen,
daß ein erheblicher Anteil der Ablehnungen nach § 522/2 ZPO der Rechtslage nicht
entspricht. Der 65. Juristentag im Jahre 2005 hat explizit vorgeschlagen beim § 522/3
eine Rechtsbeschwerde wieder einzuführen.
Der Abgeordnete Grosse-Brömer (CDU, Rechtsanwalt) kritisierte Herrn Neskovic in seiner
Aussage "der Rechtsfindung auf niedrigen Niveau", was eine Beleidigung aller
Richter sei. Es gehe auch um das Verhältnis Rechtsfrieden und Rechtssicherheit, also
darum bei streitigen Verfahren irgendwann einen Schlußstrich ziehen zu können. Die
überwiegende Mehrheit in Rechtsprechung und Literatur habe keine verfassungsrechtlichen
Bedenken. Anwälte erklären seitenlang, warum die erstinstanzliche Entscheidung falsch
ist und dann kriegen sie unter Umständen vom Berufungsgericht die Mitteilung, aus den
zutreffenden Gründen der erstinstanzlichen Entscheidung wird die Berufung
zurückgewiesen. Das sei für den Anwalt manchmal etwas mühselig und deprimierend und
für den rechtsuchenden Bürger vielleicht machmal auch nicht so leicht zu akzeptieren,
weil er meint, er hätte recht. Die im Internet veröffentlichten Hinweisbeschlüsse der
Berufungsgerichte seien sehr detailliert hinsichtlich der Bedenken in der bisherigen
Argumentation, worauf der Anwalt noch einmal eingehen könne. Letztlich sei die
Einstimmigkeit der Richter erforderlich, denen man nicht unterstellen könne, leichtsinnig
und locker zu arbeiten.
Ein Rechtsanwalt hat z.B. auch die Beratungspflicht, darüber aufzuklären, ob ein
Berufungsverfahren zu führen ist. Daraus ergibt sich, daß er sich mit der Rechtslage
auseinandersetzen muß. Wenn er dann eine umfangreiche Berufungsbegründung einlegt,
sollte er sich schon sehr sicher sein über die Erfolgsaussicht. Wenn er jedoch falsch
liegt, hat das Hinweisschreiben des Berufungsgerichts dann alle letzten Unklarheiten zum
Nichtvorliegen eines Rechtsanspruchs auszuräumen. Die nun vorliegende wahre Rechtslage
wäre dem Anwalt höchstens mühselig und deprimierend und zugleich hätte er seinen
Mandanten darüber in Kenntnis zu setzen, weshalb dieser nur noch in seltenen Fällen dies
nicht akzeptieren würde (z.B. des Nichtverstehens oder Egoismus). Die im Internet
veröffentlichten Gerichtsentscheidungen leiden unter dem Mangel des Nichtvorliegens der
gesamten Verfahrensakte und sind so abgefaßt, daß sie für sich nicht zu beanstanden,
zumindest für den Laien Fehler nicht erkennbar sind. Beanstandungsfähige rechtskräftige
Entscheidungen werden nicht veröffentlicht. Weiterhin geht es letztlich nicht darum,
irgendwann einen Schlußstrich zu ziehen, sondern erst nach Feststehen einer
Entscheidungsreife, d.h. Sachverhalt und Rechtslage sind widerspruchsfrei aufgeklärt. Mit
dem Eintritt der Entscheidungsreife haben aber die Richter Probleme, weshalb es die
Überprüfungsinstanzen gibt. Deren Erforderlichkeit hängt von der Qualität der
Rechtsprechung in einer Instanz ab. Der Gesetzgeber bestimmt demgemäß den Instanzenweg
und das Richterauswahl- und Abberufungsverfahren. Nach Ausschöpfung des Rechtswegs
müßten bei sachgemäßer Prozeßführung (Voraussetzung: übersichtliches Sach- und
Prozeßrecht) wenigstens rechtswidrige Entscheidungen, die gröbere negative Rechtsfolgen
nach sich ziehen, ausgeschlossen werden können (Verhältnismerkmal für Rechtsfrieden und
Rechtssicherheit).
Der Abgeordnete Stünker (SPD) hatte die Reform federführend mit voran gebracht. Dabei
sei man davon ausgegangen, daß die Bürger von den Gerichten nicht willkürlich
abgebürstet werden. Man habe neue Hinweispflichten eingeführt und die Güteverhandlung
vorgeschaltet, um ein konsensoales Verfahren zu fördern. Die Berufung solle aber nicht
mehr die neue zweite Tatsacheninstanz bleiben, sondern nur noch zur Fehlerkontrolle und
Fehlerbeseitigung dienen. Das Berufungsgericht habe aber die Verpflichtung darzulegen, aus
welchen Gründen es die Berufung für unbegründet hält. Bei neuen Tatsachen würde es
sich aber nicht verweigern, daß Verfahren fortzuführen. Auch einem taktischen
Verzögerungsverhalten (Herauszögerung der Zahlungspflicht, Zurückhaltung von
Beweismitteln) der Prozeßparteien sollte entgegengetreten werden. Auf welcher Grundlage
solle nun eigentlich der BGH tätig werden. Bedenklich seien sicherlich die
unterschiedlichen Zahlen, die man aus den Bundesländern hört. Aus Zahlenmaterial
Schlußfolgerungen zu ziehen, scheine doch etwas gewagt zu sein. Eine einstündige Debatte
für dieses Thema fand er überzogen. Man habe gegenwärtig in Deutschland andere Probleme
als die spezielle kleine Frage des § 522/2,3 ZPO.
Auch hier waren die Beschwerden der Anwaltskanzleien kein Thema. Im Übrigen ist das
verspätete Vorbringen von Tatsachen genügend zu entschuldigen (Unkenntnis vom
Sachverhalt, großer Umfang des Prozeßstoffs, also Auslegungssache). Die angeblich
spezielle kleine Frage des § 522/2,3 ZPO bestimmt aber in Wirklichkeit die Durchsetzung
oder Verhinderung des Rechtsanspruchs des Betroffenen maßgeblich.
Fazit: Der § 522 Abs. 2, 3 hätte drei Gründe für seine Berechtigung. Erstens kann
man dadurch die Durchsetzung eines rechtswidrigen Rechtsanspruchs mittels finanzieller
Ausdauerfähigkeit des Klägers verhindern, zweitens die sogenannten echten Querulanten,
denen jegliches Rechtsbewußtsein fehlt und drittens das taktische Verhalten. Letzteres
ist aber doppelt besetzt, nämlich wenn bekannter Maßen der taktische Gegner das Gericht
selbst ist. Die Praxis spricht eher die Sprache der Verhinderung des Rechtswegs für einen
bestimmten Personenkreis. Ein weiteres Problem ist, daß die in der Vorschrift genannten
Entscheidungskriterien nicht ermessensfrei ergehen können, weil eine konkrete Festlegung
hierzu fehlt oder erst von den Richtern aus weit verstreuter vielfältiger Rechtsprechung
zu erarbeiten wäre, die aber meißt widersprüchlich ist.
Der § 522/2 ZPO wäre, funktionierende Richter vorausgesetzt, nicht ganz abwegig gewesen,
braucht aber seine Überprüfungsinstanz durch den BGH, weil mit dieser Rechtsvorschrift
nur ein Parallelverfahren zum Hauptverfahren eröffnet wurde. Wenn eine Entscheidung des
Berufungsgerichts die Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH wegen fast derselben Kriterien
erlaubt, muß es auch dieses Recht im Falle des § 522/2 geben. Das Kriterium der Prüfung
der Erfolgsaussicht muß das Revisionsgericht hingegen nicht prüfen. In der aktuellen
Gerichtspraxis laden solche Kriterien die Richter geradezu zum Mißbrauch ein. Die hohe
Prozentzahl an begründeten Nichtzulassungsbeschwerden am BGH belegt das Versagen der
Berufungsgerichte zusätzlich.
Die Justizministerin Schnarrenberger (FDP) beabsichtigt nun die Vorschrift zu ändern
(Filmdokumentation: Patienten ohne Rechte, ARD, 19.01.11). Bei ablehnenden Beschluß soll
nun der Zugang zum BGH gegeben sein. Allerdings war da noch von einer erforderlichen
Beschwer (Streitwert der Berufung) in Höhe von 20000,- € die Rede, was in einigen
Anwendungsfällen bedenklich gewesen wäre. Inwieweit die öffentlichkeitswirksamen
Maßnahmen eines Vaters einer bei der Geburt geschädigten Tochter Wirkung zeigten, ist
offen, weil die FDP das Anliegen schon 2009 hatte.

In diesem Zusammenhang meinte RA Brocks, die Gerichte haben in der Anfangszeit diese
Vorschrift benutzt, um ihre Aktenberge loszuwerden. Da war von Gerechtigkeit keine Spur.
Die davon Betroffenen seien dadurch natürlich einem eklatanten Gerechtigkeitsmangel
unterlegen gewesen.
Im Übrigen ist auch der Rechtsausschuß in der Frage bzgl. der Berater falsch besetzt.
Eingeladen waren Vertreter des Richterbundes, ein Richter des BGH und des OLG Düsseldorf,
der Bundesrechtsanwaltskammer, jeweils ein Prof. der Uni Erlangen-Nürnberg und Heidelberg
und zwei BGH-Rechtsanwälte (Anhörung am 09.05.11, bzgl. Einführung einer
Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschwer von 20000 € nach Nichtzulassung der Berufung).
Außer den Professoren unterliegen alle Beteiligten staatlichen, finanziellen oder Kasten
-Interessen. Ein Prof., der Vertreter der BRAK und ein BGH-Rechtsanwalt lehnten die
bisherige Regelung zu § 522 ZPO ab, wobei nur letzterer (Prof. Dr. Reinelt) der Praxis am
nächsten kam und besonders mit praktischen Unrechtsbeispielen auffiel. Er legte auch
schlüssig dar, daß bereits die alten Regelungen vor 2002 den heute gewollten Zweck
erfüllten. Alle anderen waren vehemente Fürsprecher der neueren Versionen, wobei die
Nichtzulassungsbeschwerde favorisiert wurde. Es fehlten Vertreter der
Geschädigtenverbände wegen ihrer Unabhängigkeit und praktischen Erfahrungen.
Schwerpunkt der Debatte war die Effienz des Verfahrens und die Verfassungsgemäßheit. Die
Richtigkeit oder Unrichtigkeit von Entscheidungen war überwiegend kein Thema, sondern nur
die prozentuale Zahl ablehnender Beschlüsse durch die Berufungsgerichte, die Mißbrauch
u.s.w.. vermuten ließen.
Mit der geänderten Fassung 2002 wollte man die Berufung als Mittel der
Prozeßverschleppung unterbinden und eine Überlastung des BGH vermeiden. Das ist aber
völliger Humbug, weil im Schwerpunkt erstinstanzlich die vorläufige Vollstreckbarkeit
gegeben ist. Andernfalls müßte dieses Gericht entweder seiner Sache nicht sicher sein
oder erkannt haben, daß die Parteien noch ein relevantes bislang versäumtes
Vortragsrecht haben etc.. Prozeßverschleppung ist damit eigentlich nur möglich, wenn die
Richter nicht funktionieren. Das mittels Nichtzulassungsbeschwerde (nach
zweitinstanzlichen Urteil) der BGH angerufen wird, muß selbst bei hoher Rate hingenommen
werden. Das gehört zum Rechtsstaatsprinzip. Die höhere Entscheidungsqualität des BGH
kann man nicht einfach auf die unteren Gerichte mit schlechterer Entscheidungsqualität
verlagern.
Schlußendlich ist nun der § 522 ZPO so abgeändert worden, daß im Abs. 2 die
Begründungspflichten des Gerichts erweitert wurden und im Abs. 3 dem Berufungsführer das
Rechtsmittel eingeräumt wurde, daß bei einer Entscheidung durch Urteil zulässig wäre.
Die Zurückweisungsgründe hat man für den Fall ergänzt (Ziff. 4), wenn eine mündliche
Verhandlung nicht geboten ist.
Hier haben sich scheinbar auch die ablehnenden Parteien umentschieden und für den Antrag
der FDP gestimmt. Es sah so aus als sei die Nichtzulassungsbeschwerde nun in den Fällen
des Abs. 2 gegeben sei. Mit Ziff. 4 will man offenbar all diejenigen ausschließen, wo es
nur noch um Kostenfragen geht oder bei Entscheidungen des Berufungsgerichts, die keine
Urteile sind (§ 128 Abs. 3 und 4 ZPO).
Wenn man das aktuelle Berufungsrecht von der Seite der Gerichtspraxis betrachtet, hat man
damit rechtswidrige Gerichtsentscheidungen da legitimiert, wo die Sachlage (anhand der
Parteischriftsätze, Beweisführung, Gerichtsprotokolle, neues Vorbringen, etc.)
"erschöpfend" geklärt scheint (§ 529 - 532 ZPO). In diesen Fällen wäre eine
Berufung unzulässig. Die Ziffern 2 und 3 sind nicht anwendbar bei solchen
Fehlentscheidungen, sondern nur bei einer Fortbildung des Rechts oder unterbliebenen oder
falschen Anwendung geltenden Rechts durch den Richter. Beides wird von den
Berufungsrichtern etc. häufig ignoriert. Schlußendlich heißt das, die Rechte des
Bürgers sind theoretisch gegenüber der Vorgängerversion zwar verbessert worden, aber
nur marginal. Es dürfte nicht im Sinne des Volkswillens sein, daß Abgeordnete den
Rechtsbruch von Richtern sanft erschweren, sondern daß sie ihn vollständig verhindern.
Man muß bedenken, daß theoretische Berufungsrecht vor 2002 war viel besser, aber in
Bezug auf das Richterverhalten auch wirkungslos.
Die Rechtsbeschwerde war dann in der dann eingeführten Praxis die übliche
Rechtsbeschwerde, wie sie auch in einigen anderen Fällen gesetzlich geregelt ist. Mit ihr
kann man keine inhaltliche Sachprüfung mehr fordern, sondern nur gegen schwere
Verfahrensverstöße vorgehen, wenn grundsätzliche Bedeutung vorliegt, die
Rechtsanwendung unvertretbar ungleich gehandhabt wird oder eine Fortbildung des Rechts
erforderlich ist. Im Jahre 2021 kann man sagen, die ganze Diskussion im Bundestag hatte
jedoch nur eins im Auge, den Rechtsschutz durch Überprüfung mittels zweiter Instanz zu
verkürzen und Rechtsbruch der Gerichte zu verschleiern.
Herr Gehb, Frau Zypries, Herr Grosse-Brömer und Herr Stünker stellen nach dieser
Ausarbeitung Vertreter dar, die schon mehr mit Vorsatz die Rechtsweggarantie und
Durchsetzung des Rechtsanspruchs des Bürgers ausgehöhlt haben.
Die Einlegung der Verfassungsbeschwerde steht eigentlich jedem zu. Die Praxis zeigt
aber, daß das Bundesverfassungsgericht, wenn überhaupt, nur anwaltlich eingelegte
Verfassungsbeschwerden oder solche mit PKH-Antrag akzeptiert. Zu den
Zulässigkeitsvoraussetzungen bzgl. einer Verfassungsbeschwerde zählen die vorherige
Einlegung aller zulässigen (auch umstrittenen) Rechtsbehelfe (auch Ablehnungsgesuche,
Verfahrensrügen (§ 295 ZPO), Gehörsrüge, Einspruch, Wiederaufnahmeverfahren,
Drittwiderspruchsklage etc.) und je nach vorgeschriebenen Rechtsweg die Rechtsmittel
Berufung, Revision und die Beschwerde. Die Verfassungsbeschwerde sollte vorsorglich schon
innerhalb einer Monatsfrist nach dem letztinstanzlichen Urteil oder Beschluß erhoben
werden, da eine Unzulässigerklärung der Gehörsrüge durch das BVerfG nicht
ausgeschlossen werden kann. Wenn die Rechtssache von allgemeiner Bedeutung ist oder dem
Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, ist die Erschöpfung
des Rechtswegs nicht erforderlich, aber man sollte ihn bis dato verfahrenskorrekt
angegangen sein. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist nicht erforderlich (s. z.B. Jarass,
Grundgesetzkommentar, 5. A., Art. 93; Begr BTDrs 15/3706 S. 14, NJW 2008, 543) jedoch für
nachfolgende Staats- und Amtshaftungsprozesse.
Der Literatur und Rechtsprechung kann mit Ach und Krach folgendes entnommen werden:
Gerügt (§ 295 ZPO) werden muß bei Auftreten eines Verfahrensverstoßes sofort in der
Verhandlung und ansonsten bis spätestens zum Schluß der nächsten mündlichen
Verhandlung und nicht mehr nach der Hauptsacheverhandlung, jedoch noch in Rechtsmitteln
und bei schriftlichen Verfahren im nächsten Schriftsatz. Ein Richterablehnungsgesuch muß
mit Kenntnis des Ablehnungsgrundes sofort erfolgen (Prozeßhandlungen, wie Anträge etc.
dürfen inzwischen nicht vorgenommen worden sein) und kann auch nach einer
Hauptsacheverhandlung eingelegt werden. Ergibt sich der Ablehnungsgrund erst aus einer
gerichtlichen Entscheidung ist ein Ablehnungsgesuch unzulässig, wenn die Instanz beendet
oder Rechtskraft eingetreten ist. Diese treten erst ein, wenn die Entscheidungen über
noch eingelegte Rechtsbehelfe (Gehörsrüge; (bei Tatbestands- oder
Protokollberichtigungsantrag, Gegenvorstellung streitig) ergangen sind. Die
Gegenvorstellung soll bei Verfahrensverstößen erfolgen und zwar da, wo die Gehörsrüge
(§ 321a ZPO) nicht greift. Dann konnte man auch noch eine Außerordentliche Beschwerde
auf Beschlüsse einlegen, die nicht der Rechtskraft unterliegen (NJW 2009, 3054). Dem
stehen inzwischen die Entscheidungen in NJW 2009, 829; 2007, 2538; 2006, 861 [Nr. 25] und
aktuellere Rechtsprechung entgegen. Gem. der Rechtskommentierung sei hier aber noch
Nachbesserungsbedarf des Gesetzgebers erforderlich. Bei der Außerordentlichen Beschwerde
besteht wegen der uneinheitlichen Rechtsprechung das größte Risiko, daß sie für
unzulässig erklärt wird. Aber alle in der Rechtsprechung streitigen Rechtsbehelfe bzgl.
Zulässigkeit und Statthaftigkeit müssen eingelegt werden.
Es fehlt also an einer besser ersichtlichen Trennung und Handhabung der Rechtsbehelfe. Es
bedarf auch eines hohen Fachwissens, um Verfahrensverstöße etc. zu erkennen und
einzuordnen. Rechtsvortrag dazu und welche Entscheidung hätte ergehen müssen und der
Nachweis warum, wird selbst vom PKH-Antragsteller verlangt. In der Frage des
Ablehnungsgesuchs, der Verfahrensrüge, der Gegenvorstellung und Gehörsrüge liegen
meißt Überschneidungen in der Begründung vor wegen der nicht immer leicht zuzuordnenden
Art und Schwere des Verfahrensverstoßes, aber Unterschiede bzgl. ihrer zeitlichen
Einlegung und Wirkung. Man muß also vorsorglich und aufgrund der Richtertricksereien alle
diese Rechtsbehelfe gleichzeitig einlegen, die Gehörsrüge jedoch erst nach
letztinstanzlicher Entscheidung, in Sonderfällen auch bei Richterablehnungsverfahren und
weiteren Ausnahmen. Gegen den Gehörsbeschluß sollte als endgültiger Rechtsbehelf
vorsorglich wiederum eine Gegenvorstellung eingelegt werden, wenngleich dieses Recht
streitig ist. An sich ist sie nur noch bei nicht materiell rechtskräftigen Entscheidungen
zulässig.
Wenn man diesen Verfahrensspießrutenlauf verfahrenskorrekt bewältigt hat, kommt man
anschließend idR nicht zu der erhofften Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht,
weil die Annahme einer Verfassungsbeschwerde als begründet offenkundig nur irgendwelchen
ausgesuchten Fällen vorbehalten ist. Erfolglos können auch Beschwerdeführer sein, die
einen rechtswidrig verursachten Tod eines Angehörigen beklagen, die zu Unrecht hinter
Gittern sitzen, die der Gerichts- und Behördenwillkür ausgeliefert, verschuldet oder aus
der Gesellschaft ausgegrenzt sind etc. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet lieber
über harmlosere Fälle. Wenn dann ein ablehnender Beschluß des BVerfG wegen fehlender
Erfolgsaussicht zugestellt wird, obwohl nur eine vorsorgliche Verfassungsbeschwerde ohne
Begründung und Unterlagen eingereicht war, kann man davon sprechen, daß andere den
Beschluß abgefaßt und die Verfassungsrichter ihn nur unterschrieben haben. Wenn man dann
noch weiß, daß höchste Fachgerichte floskelhafte Entscheidungen ohne Substanz fällen
bei berechtigten Ansprüchen der Betroffenen, liegt nahe, daß der Begriff Rechtsstaat nur
ein Fake sein kann. Dieses Verhalten des Bundesverfassungsgerichts ermutigt die Richter
der unteren Gerichte, willkürlich zu entscheiden, wozu sie auch häufig Gebrauch machen.
Daneben sind sie scheinbar selbst nicht immer in der Lage geltendes Recht richtig zu
erfassen.
Die Nichteinlegung der Rechtsbehelfe darf bei o.g. Bedingungen nicht zur Unzulässigkeit
einer Verfassungsbeschwerde führen. Da das BVerfG keine Begründungspflicht mehr hat,
wird aus deren Beschlüssen meißt auch nicht ersichtlich, was zur Unzulässigkeit oder
Unbegründetheit der Verfassungsbeschwerde führte. Gern wird hier auch in höchst
fragwürdiger Weise fehlende hinreichende Erfolgsaussicht moniert. Besser als bei einer
anwaltlichen Vertretung, muß sich eine rechtsunkundige Prozeßpartei auf ein
ordnungsgemäßes Verhalten der Richter verlassen dürfen. Daraus folgt, wenn aus einer
Verfassungsbeschwerde gegen die Grundrechte verstoßende Verfahrensfehler ersichtlich
sind, die zu einer rechtswidrigen oder unrichtigen Entscheidung geführt haben, muß sie
Erfolg haben. Lediglich eine völlig unbeeinflußte Willensbekundung der Prozeßpartei,
daß sie den Verfahrensfehler trotz der ihr bekannten Folgen nicht rügen will, darf zu
einer Ausnahme führen. Abgesehen davon, sind in der Gerichtspraxis aber auch viele
Anwälte und Richter weit entfernt davon, dieses Rechtsbehelfsrecht ordnungsgemäß
anzuwenden. Das trifft bei Anwälten auch für die Gehörsrüge nach § 321a ZPO zu, was
dann fast immer jeglichen Grundrechts- und Schadensersatzanspruch gegen den Staat schon
von vornherein zunichte macht. Es ist wegen der Gerichtspraxis zu vermuten, daß mit der
Einführung des § 321a ZPO im Jahre 2002 (geändert 2004) genau das bezweckt war. In
Prozeßkostenhilfeverfahren und in Verfahren ohne anwaltliche Vertretung bei ähnlicher
Einkommenssituation muß auf jeden Fall die Pflicht zur Einlegung dieser Rechtsbehelfe
(auch der Gehörsrüge § 321a ZPO) völlig entfallen, weil dem Antragsteller die Kenntnis
von den rügefähigen Verfahrensfehlern etc. nicht zugemutet werden kann. Die
Zumutbarkeitsfrage wird in der offiziellen Rechtsprechung in Einzelfragen zwar
angesprochen, es gibt aber weder eine systematische noch einheitliche Rechtsprechung dazu.
Desweiteren wäre ein Verweis auf das Beratungshilferecht nur vorgeschoben. Denn dazu muß
der Prozeßpartei zunächst einmal klar sein, daß es neben dem Problem eines
pflichtwidrig beratenden RA solche Hürden gibt und daß ein Verfahrensfehler aktuell
vorliegt. Das ist mit diesem Recht, daß ohnehin nur vor und außerhalb von
Gerichtsverfahren genutzt werden kann, schwer realisierbar. Teilweise wird neben einem
bereits laufenden PKH-Verfahren eine Beratung und ggfs. Vertretung bewilligt. 15 €
kostet das idR aber trotzdem noch.
Bei Häufung von Verfahrensverletzungen durch die Gerichte, die permanent vorkommen, wäre
es zudem nicht zumutbar, wenn von den höherinstanzlichen Gerichten und dem BVerfG
trotzdem verlangt würde, daß die Prozeßpartei jedes Mal das Rügerecht etc. einzuhalten
habe (Köln OLGR 98, 56; mißverständl. BGH MDR 79, 567). Sie macht dabei zwangsläufig
Fehler. Insgesamt muß es auch den höherinstanzlichen Gerichten zumutbar sein, nur aus
dem Sachvortrag einer Partei, das begehrte Ziel oder die gerügte Rechtsverletzung zu
ergründen. Das kann evtl. der Effektivität des Anliegens nicht immer gerecht werden, was
aber durch klare Abfragen der Gerichte weitgehendst korrigiert werden könnte. Insoweit
wird die Aufklärungs- und Hinweispflicht von den Gerichten, abgesehen von dem Makel ihrer
vielen Falschmeldungen zur Sach- und Rechtslage, die abgestellt werden muß, viel zu
restriktiv gehandhabt. Die fristgebundenen Vortragsbeschränkungen an den höchsten
Gerichten haben deswegen zu entfallen. Eine Unzulässigkeit oder Unbegründetheit eines
Rechtsmittels, weil im Vortrag Verfahrensfehler nicht vorschriftsmäßig gerügt, etwas
vergessen, unverschuldet übersehen oder spezielle Vortragspflichten nicht bekannt sein
konnten, darf es nicht geben.
Bei der aktuellen Gerichtspraxis führt die Einhaltung der aktuellen Regeln zudem zum
Kreisverkehr, weil mit jeder Entscheidung häufig ein sich wiederholender Rügegrund
(Ablehnungsgrund) vorliegt, nämlich die fehlende Auseinandersetzung mit zentralen Punkten
des Parteivorbringens in den Entscheidungsgründen, Fehlen wesentlichen Tatsachenvortrags
im Urteil und die Gehörsverletzung (Zöller, ZPO, 28. A., § 42 Rn 23, 24, BAG MDR 71,
248; Meyer-Ladewig/…, SGG, 10. A., § 136 Rn 7f, 7 h). Besondere Umstände für die
Annahme einer Gehörsverletzung bei gerichtlichen Entscheidungen liegen vor, wenn das
Gericht auf den wesentlichen Kern des Vortrags einer Partei zu einer zentralen Frage des
Verfahrens nicht in den Entscheidungsgründen eingeht ((BVerfG 86, 133/145 f; BVerfG-K,
NJW 95, 1885).
Wenn den Entscheidungsgründen selbst im Rahmen eines PKH-Verfahrens (BVerfGE 54, 46:
Zöller, ZPO, 27. A., Rn 3 ff vor § 128, § 313 Rn 19) nicht entnommen werden kann, auf
welche Tatsachen und Beweise sich die Entscheidung stützt, stellt das eine
Gehörsverletzung dar (Zöller, ZPO, 27. A., § 321a Rn 7). Bei einer
Überraschungsentscheidung ist ebenfalls das Gehör verletzt (NJW 03, 3687). Ein Gericht
hat gem. stRspr den Vortrag einer Partei zur Kenntnis zu nehmen, in Erwägung zu ziehen
und in gewissen Grenzen in den Entscheidungsgründen zu verarbeiten, ansonsten liegt eine
Gehörsverletzung vor (BVerfG NJW 94, 2683). Eine Gehörsverletzung soll neben Willkür
und Mißbräuchlichkeit auch vorliegen, wenn die Rechtsanwendung
"offensichtlich" unrichtig ist (offensichtlich = deutlich erkennbarer
Auslegungsfehler; BVerfGE 69, 145/149).
Schwerpunkte von Verfahrensverstößen liegen im Fehlen der gebotenen Objektivität und
Sachlichkeit, in unrichtigen Rechtshinweisen, im Unberücksichtigtlassen von
Beweisanträgen und in der Art der Zeugenbefragung durch das Gericht, in den Hinweis- und
Aufklärungspflichten, in der Verhandlungsführung und -protokollierung, im vorzeitigen
Abschluß des Verfahrens (fehlende Entscheidungsreife), in Überraschungsentscheidungen
und in den Entscheidungsgründen.
(s. Kommentar, Zöller, ZPO, zu §§ 42, 136 - 139, 295, 313, 321a, Gegenvorstellung (s.
Sachwortregister); Meyer-Ladewig/…, SGG-Kommentar)
Der Nachweis, daß Ministerpräsidenten, Justizminister, Gerichtspräsidenten etc.
selbst grob rechtswidriges Verhalten von Richtern tolerieren, kann wie folgt geführt
werden. Der übliche Einwand derselben ist, die eingelegte Dienstaufsichtsbeschwerde
beträfe lediglich den Kernbereich richterlicher Unabhängigkeit, in die ein Dienstherr
nicht eingreifen darf.
Aufgrund des § 26 Abs. 2 DRiG ist eine Dienstaufsicht nicht ausgeschlossen, wenn ein
offensichtlicher, jeden Zweifel entrückter Fehlgriff (des Gerichts) vorliegt (BGH NJW-RR
08, 1660, 1661) oder es um Fragen geht, die dem Kernbereich soweit entrückt sind, daß
sie nur noch als der äußeren Ordnung zugehörig anzusehen sind (BGH NJW 08, 1450).
Auf S. 6 in BGHZ 70, 1 finden wir, „Dem Richter kann nicht vorgeschrieben werden,
welche Wertung er im Einzelfall aufgrund welcher Sachlage als tatsachenadäquat ansehen
darf (Grundsatz der freien Würdigung). Der Bereich seines Ermessens endet erst dort, wo
sein Werturteil als offensichtlich abwegig erscheint.“
„Die richterliche Unabhängigkeit ist kein Grundrecht im Sinne des § 90 BVerfGG und
kein Standesprivileg (BVerfGE 27, 211/217; Benda DRiZ 75, 166/170), sondern ein Ausfluss
der Gewaltenteilung. Rechtfertigung und Schranke findet sie in Bindung des Richters an
Recht und Gesetz. Rechtfertigung und Schranke findet sie in der Bindung des Richters an
Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 2, Art. 97 Abs. 1 GG; § 1 GVG; § 25 DRiG). Ohne diese
Bindung kann es keine geordnete Rechtspflege geben, ist der Staat nicht in der Lage, seine
Justizgewährungspflicht zu erfüllen. Sein berechtigtes Interesse, die Abhängigkeit von
Gesetz und Recht als unverzichtbares „Komplementärelement“ des
Unabhängigkeitsprinzips auch im Wege der Dienstaufsicht sicherzustellen, kann kaum
bestritten werden (Baur, DRiZ 73, 6). Aber es würde weit über die be-rechtigte
Wahrnehmung dieses Interesses hinausführen, wenn die Dienstaufsicht eine den äußeren
Ordnungsbereich überschreitende Beanstandungskompetenz erhielte, die ihr die Möglichkeit
gäbe, ein sachbezogenes Unwerturteil (vgl. BGHZ 51, 363/370) schon unter der
Voraussetzung zu fällen, daß sie Feststellungen für falsch hält, die Rechtsanwendung
für fehlerhaft ansieht oder das Verfahren als gesetzwidrig betrachtet (BGH DRiZ 67, 239).
Erst der dem Urteil offensichtlich entrückte Fehlgriff kann es dem Dienstvorgesetzten
gestatten, dem Richter vorzuhalten, daß er nicht gesetzestreu gehandelt habe (DRiZ 70,
73/74 u.a .).“
Hierzu wird dann gern von den Dienstherrn festgehalten, ohne dies zu begründen, daß es
keine Anhaltspunkte dafür gäbe. In diesen Bescheiden wird regelmäßig und gegen das
Recht verstoßend nicht auf den Inhalt der Dienstaufsichtsbeschwerde/Petition eingegangen
(GG, Schmidt-Bleibtreu, Klein, 9. A., Art. 17 Rn 7 (BVerGE 2, 230; 13, 90; BVerfG BVBL.
93, 32 ff.und noch weitergehende Literaturstellen)). Das dient der Verschleierung der
rechtbrechenden Entscheidung (Pflichten: allgemein das Grundgesetz, s. auch
Beamtenstatusgesetz § 36, § 38 Abs. 1, § 47). Hinsichtlich einer unterlassenen
Beschwerdeentscheidung, unzureichenden Begründung oder bzgl. der Richtigkeit einer
Entscheidung iVm mit dem Sinn und Zweck des Pertitionsrechts kann der Betroffene Klage
beim Verwaltungsgericht erheben. IdR kann eine qualifizierte Begründung und korrekte
Entscheidung immer noch nicht erreicht werden, weil dies der Gesetzgeber nicht verlangt.
---------------
Hinsichtlich des Verbraucherschutzes bei Telefonwerbung meinte die Justizministerin
Zypries, heute (Phoenix, 26.03.09) wäre es ein guter Tag für die deutschen
Verbraucherinnen und Verbraucher, weil man es mit dem neuen Gesetz geschafft habe,
wirksame Regeln dem Mißbrauch in der Telefonwerbung entgegenzusetzen.
Man hat nun ein Widerrufsrecht bei Zeitung, Zeitschriften, Wetten und Lotterie
eingeführt. Bei Dienstleistungen wie der Telekommunikation u.a. bedarf es nunmehr bei
allen Umstellungen einer schriftlichen Bestätigung des Kunden, daß er bereit sei, den
Anbieter zu wechseln. Die Rufnummern des Anbieters dürfen nicht unterdrückt sein.
CDU/CSU, SPD und FDP stimmten dem zu. Grüne und Linke lehnten das Gesetz ab. Die Linken
verlangten in allen Fällen eine schriftliche Bestätigung durch den Kunden. Die Grünen
verlangten, es müsse eine Einwilligung zum Anruf durch den Anbieter in Textform
vorliegen. Einer schriftlichen Bestätigung für einen telefonischen Vertragsabschluß
bedürfe es dann aber nicht. Zu vermuten ist, daß der Widerruf noch greifen soll.
Bei dem Letzteren haben wir das Problem, daß der Kunde die Unrichtigkeit eines
telefonischen Vertragsabschlusses immer noch nicht beweisen kann. Hinsichtlich des
Widerrufs muß der Kunde erstens erkannt haben, daß er überhaupt einen Vertrag
abgeschlossen hat, abgesehen davon, ob dies überhaupt geschehen ist. Dann bedarf es einer
beweisrechtlich gesicherten Zustellungsweise des Widerrufs an den Anbieter. Der Kunde muß
hierzu zudem die Zustellungsadresse innerhalb der Widerrufsfrist ermitteln, was wohl nicht
immer leicht sein dürfte.
Die Linken lagen als einzige richtig, ohne dies allerdings plausibel genug begründet zu
haben, denn allein der Anruf des Anbieters genügt, um einen Vertragsabschluß zu
suggerieren. Man denke an die im Umlauf befindlichen Kundendaten. Ergo kann nur, wie
bisher, sofortiges Auflegen des Hörers sichern, daß ein Vertrag in dieser Zeitspanne und
von der Wortwahl her nicht zustande gekommen sein kann.
Es steht dem Staat nicht an, dem Bürger solche Vertragsrisiken zuzumuten.
Ubrigens wurde in der Sendung Escher (MDR, 04.06.09) von einem Call-Center berichtet, daß
ein nur gewünschtes Zuschicken von Informationsunterlagen als Vertragsabschluß wertete
und dies sogar durch Tonmitschnitt belegen wollte. Der Vertrag wurde einige Wochen später
zugesandt. Einen danach eingelegter Widerruf wies man wegen Verfristung zurück, da der
Vertrag am Tag des Telefongesprächs zustandegekommen sei. Ein Inkassoverfahren wurde
angedroht.
Der Anwalt in der Sendung rät, sofort aufzulegen und auf keinen Fall längere
Diskussionen führen. Der Gesetzgeber habe die Chance verpaßt und gegen den Rat fast
aller Experten, nämlich eine Bestätigungslösung, o.g. Variante mittels Widerruf
gewählt. Die Lobbyisten der Call-Center-Branche hätten dort ganze Arbeit geleistet.
Die Call-Center werden vom Staat stark gefördert, die Gewinne sind hoch, aber die
Mitarbeiter erhalten Niedrigstlöhne (frontal21, ZDF, 26.05.09).
Die Situation in der Telefonwerbung soll sich trotz des Gesetzes nach einem Jahr
verschlechtert haben und ganz besonders im Gewinnspielbereich (Panorama, ARD, 01.07.10).
Der Rechtsanwalt Stefan Richter hält dazu fest, wenn der Expertenvorschlag (schriftlicher
Vertrag) im Gesetz zur Anwendung gekommen wäre, dann wäre der illegalen Werbung
schlichtweg die Grundlage entzogen worden. Die Bundesnetzagentur macht die
"Hoffnung", daß die Entscheidungen in 9 laufenden Ordnungswidrigkeitsverfahren,
die allerdings beweisrechtlich schwierig sind, abschreckend wirken werden.
Für die neue Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) ist klar, man habe
die Lücken geschlossen, die es im Gesetz gegeben hat. Warum immernoch so viele
Beschwerden kommen und anschließend so wenig Ordnungsverfahren eingeleitet werden,
vielleicht wegen zu allgemeiner Beschwerden oder ist es zu aufwendig, kann sie jetzt nicht
erklären und will sie auch nicht versuchen für sich zu erklären (PlusMinus, ARD,
27.07.10).
Da hat sie wohl ihren Ministerauftrag völlig mißverstanden?

Wegen dieser Statistik der Bundesnetzagentur über Bürgerbeschwerden sieht nun die
Ministerin Handlungsbedarf und will die Verschärfung von Gesetzen prüfen (Frontal21,
ZDF, 03.08.10).

Offenbar will sich die Politik nun doch zu dem durchringen, was logisch und vernünftig
ist und Verbraucherschützer etc. seit langem gefordert hatten.
Zum geplanten neuen Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken können weiterhin Abbo-
und Mobilfunkverträge am Telefon abgeschlossen werden (Escher, MDR, 28.02.13). Hierzu
meint der Abgeordnete Marco Wanderwitz (CDU), im sehr mißbrauchsanfälligen Bereich der
Gewinnspiele bedarf es künftig der Zustellung eines unterschriftspflichtigen Vertrages
(Bestätigungslösung). Im Gegensatz zur Meinung der Verbraucherschutzzentrale würde man
das, was funktioniert, mit einer unnützen Schwelle, nämlich einem unnötigen
Papieraustausch, versehen.
Im Hintergrund steht hier sicherlich der zusätzliche Aufwand der Firma, der damit
verbunden ist. Dieser Begründung fehlt trotzdem die Verhältnismäßigkeit völlig, weil
die Abgeordneten allein wegen eines Papieraustausches,
den finanziellen Schaden Tausender in Kauf nehmen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In der Frage der in den 90er Jahren und in diesem Jahrzehnt verabschiedeten Gesetze zur
Liberalisierung des Finanzmarktes, die die Herbeiführung der Finanzkrise erheblich
begünstigten, meint der Abgeordnete Gerhard Schick (B90/Die Grünen), daß es uns nicht
gelingt, die Finanzmärkte wirksam zu regulieren, weil die Kraft der Finanzbranche so
stark ist, diese Regeln zu verhindern. Prof. Albrecht hält dazu fest, man könne sagen,
was die Finanzlobby will, auch umgesetzt wird in diesem Lande (Kontraste, ARD, 26.08.10).
Z.B. war im Juni 2003 vom Bundestag das Kleinunternehmenförderungsgesetz verabschiedet
worden. In dem Gesetz waren die Gewerbesteuerbefreiungen für Verbriefungen vom
Bundesfinanzministerium geschickt verpackt worden, die den Banken ungeheure Profite
beschert. Die Abgeordneten seien ahnungslos gewesen und hätten geglaubt, es gehe nur um
Mittelstandsförderung. Laut Prof. Schwintowski hätten die Abgeordneten wahrscheinlich
garnicht bemerkt, daß sie ganz gigantische Risiken der Banken gerade von der
Gewerbesteuer befreit haben und ihnen sei nicht bewußt gewesen, was sie hier tun, weil
sie glaubten, sie machen Mittelstandsförderung.
Solche Aussagen untermauern zunächst die Vermutung, der Abgeordnete beschäftigt sich
nicht mit den von der Regierung oder den Fraktionen vorgelegten Gesetzen und segnet sie
unzureichend geprüft ab. Solche Abgeordneten würden demnach nicht sachgerecht die
Bürgerinteressen vertreten, wozu sie eigentlich berufen sind. Sicherlich wird es ein paar
Abgeordnete geben, die ihren Job aus unzureichender Jura-Kenntnis etc. schlecht machen,
jedoch dürften die Abgeordneten meistenteils nur als Befehlsempfänger funktionieren,
denn unter ihnen sind auch viele Rechtsanwälte und Richter vertreten. Hätte nur einer
von ihnen besagte Mängel in seiner Rede in der Bundestagsdebatte über das Gesetz
aufgezeigt, wäre das Gesetz bei unabhängigen Abgeordneten so nicht zustande gekommen.
Wie man hier sieht, wirken so manche Fernsehbeiträge auch irreführend. Die
Wahrscheinlichkeit, daß alle Abgeordneten bei diesem Gesetz geschlafen haben sollen, ist
höchst unwahrscheinlich. Es stellt sich auch die Frage, wie sieht die Kraft der
Finanzbranche auf die Abgeordneten aus, weshalb die dann kapitulieren.
-----------------------
Anmerkung:
Wer die Bundestagsdebatten genau beobachtet und dabei den Sachverstand einschaltet, muß
feststellen, daß sich die Parteien vom Gewillkürten/Unplausiblen bis zum Plausiblen
abstufen. Am Unplausibelsten argumentiert die CDU/CSU gefolgt von SPD, FDP, Grüne und
Linke. Gegenüber den Linken besteht ein größerer Abstand. Aber auch die Linken sind
nicht in allen Punkten Plausibel. Und Folge der bestehenden Demokratieform ist, daß die
daraus und aufgrund des parteikonformen Abstimmungsverhaltens der Abgeordneten,
insbesondere der Koalition, entstehenden Gesetze Schädigungswirkung bei einem Teil der
Bevölkerung zwangsläufig haben. Es ist also eine Demokratieform, die zwangsläufig
Unrecht, auch mit schwersten Folgen, erzeugt und damit Unzufriedenheit, Haß und sogar
Gewalt schafft.
Der augenblicklichen Demokratiekonstellation fehlt von seiten der gewählten Parteien die
Anpassungsfähigkeit, wieder demokratisch zu werden. So genügte es z.B., daß Vorschläge
des Bundespräsidenten Horst Köhler zu mehr Transparenz der Abgeordneten oder
Volksabstimmung bzgl. der Wahl des Bundespräsidenten kategorisch von CDU bis Grüne
ausgeschlossen wurden, um solche Debatten gleich im Keim zu ersticken.
Viele Geschädigte sollten sich also nicht wundern, was die Ursache ihrer Schädigung ist.
Sie sind nämlich Opfer einer sogenannten Realpolitik. Wenn erst einmal, wie geschehen,
eine einseitige Staatsführungsstruktur entstanden ist, ist die Theorie vom demokratischen
Gedanken weitgehendst verspielt. An sich bedürfte es also einer oder mehrerer
Führungsparteien mit viel und alleinigen Sachverstand, die es aber offenkundig nicht
gibt. Um überhaupt Bewegung in das Problem zu bringen, müßten zunächst und allein
entweder die kleineren Parteien ins Führungsamt durch die Wahlen gehievt werden oder man
erreicht eine Wahlbeteiligung von weniger als 30 %, um allgemein neues Verhalten der
politisch Verantwortlichen zu erzwingen. Wozu auch die Rehabilitierung der Geschädigten
gehört. Allerdings führte z.B. die äußerst geringe Wahlbeteilung in Polen dort zu
keinem anderen politischen Verhalten. Wenn jedoch infolge einer doch entstandenen neuen
Parteienkonstellation etc. trotzdem gnadenlos im alten Trott weitergemacht wird, ist der
praktisch gewollte Demokratiegedanke vollends verspielt.
In der Frage der Anpassungsfähigkeit, wieder demokratisch zu werden, stellt sich das
Problem auch beim Lissabon-Vertrag ähnlich dar. Um demokratisch zu sein, muß er dies
auch gewährleisten. Derzeit wird aber zu recht, neben der Volksferne, den Regeln der
Stimmgewichtung (wegen angeblicher Blockadekoalitionen etc.), Auslandseinsätzen u.a.,
noch bemängelt, daß der EU-Kommissar und der Vertreter des jeweiligen Landes im
Ministerrat nicht demokratisch, also nicht volkslegitimiert, in ihr Amt gelangen.
-----------------------------------------------
Bzgl. den PKH-Änderungswünschen der Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger kann
man nur sagen, daß sie ihren Sonderstatus gegenüber sonstigen Verhaltens der FDP
verspielt hat. Sie plant, um die Länder zu entlasten, z.B., daß Bürger ohne anwaltliche
Vertretung vor Gericht auskommen müssen (Monitor, ARD, 24.01.13). Mit Anwalt sind die
Prozesse zwar häufig unsicher, weil er seine Aufgaben aus verschiedensten Gründen nicht
sachgemäß wahrnimmt, aber ohne Anwalt ist der Bürger völlig hoffnungslos der Willkür
des Gerichts und der Schliche der Gegenpartei ausgeliefert. Weiterhin soll die
Beratungshilfe ganz entfallen. Das hätte den positiven Vorteil, daß sich die Bürger
selbst das Recht aneignen müßten, wenn sie es nur könnten. Die Beratungshilfe führte
wegen absichtlicher Falschberatung sicherlich auch dazu, daß Bürger sinnlose Prozesse
geführt haben. Eine Rückzahlungspflicht von PKH gibt es bereits, wenn sich die
Einkommensverhältnisse der Prozeßpartei besserten. Das aber eine ratenfrei bewilligte
PKH nach alten Recht durch das neue Recht rückzahlungspflichtig werden soll, ist
juristisch nicht haltbar, weil der Betroffene der Entscheidung des Gerichts vertrauen
durfte und er sein handeln danach bestimmte. Das, was zu Zeiten des kalten Krieges
zwangsläufig eingeführt werden mußte und zu einem Rechtsstaat eigentlich sowieso dazu
gehört, will man offensichtlich langsam wieder abbauen.
Aus dem Bundesjustizministerium heißt es zum neuen Gesetz völlig weltfremd:
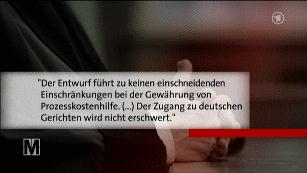

Noch mehr Digitalisierung schmeckt den Gerichten so gar nicht, weil ihre Machenschaften
einschränkt. Schon jetzt bieten die unteren Gerichte eine Rechtsmitteleinlegung etc.per
Mail als eine dann der Form (Zustellungserfordernis) entsprechende Einlegung nicht an. Die
höheren Gerichte haben zwar eine Mail-Adresse, aber der Nachweis der Zustellung durch
Eingangsbestätigung unterbleibt. Insbesondere die höheren Gerichte manipulieren auch
ihren Fax-Empfang, was so weit gehen kann, daß eine Zustellung per Fax unmöglich wird.
zurück